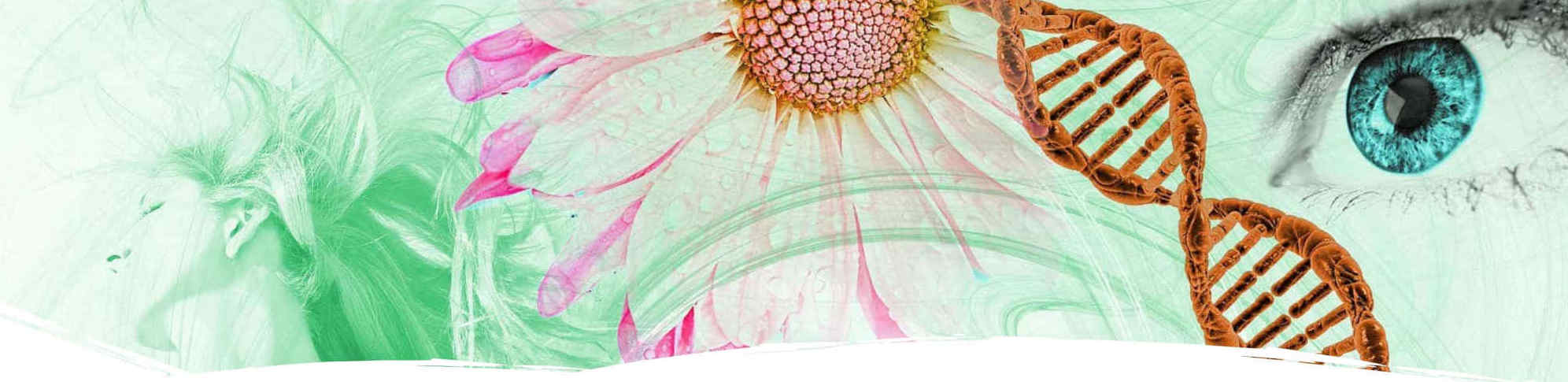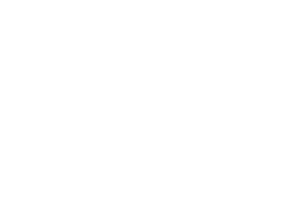Die Kamille, eine einjährige Pflanze mit filigranen weißen Blüten, hat eine lange und vor allem vielseitige Geschichte. Sie wurde schon in der Antike als Heilpflanze verehrt und ist Inhalt vieler Mythen. So wurde die Kamille in Ägypten als die Blume des Sonnengotts verehrt und bei den Kelten galt sie als heiliges, schützendes Kraut.
Bis heute ist die Kamille ein Symbol für Hoffnung, Ausgeglichenheit und Stärke. Und sie gilt als beliebte Heilpflanze, die bei verschiedenen Leiden zum Einsatz kommt.
Botanischer Name:
Matricaria chamomilla
Englischer Name:
Chamomile
Weitere Bezeichnungen:
Echte Kamille, Deutsche Kamille, Mägdeblume, Kummerblume, Apfelblümlein, Feldkamille, Hermel
Verwendete Pflanzenteile:
Bei der Kamille werden vorwiegend die Blüten verwendet. Sie eignen sich für einen Kamillentee sowie für eine Kamillentinktur.
Auch das Kraut und die Samen können genutzt werden, doch der Großteil der ätherischen Öle steckt in den Blütenköpfen. Für die Gewinnung von ätherischem Kamillenöl ist hauptsächlich der gelbe Teil der Kamillenblüte von Bedeutung.
Auch interessant:

Inhaltsstoffe:
- Ätherische Öle
- Borneol
- Schleimstoffe
- Apiin
- Azulen,
- Chamazulen
- Bitterstoffe
- Flavonoide
- Gerbstoffe
- Cumarin
- Farnesol
- Oleanolsäure
- Salicylate
- Schwefel
- Thujon
Wirkung:
- entzündungshemmend
- krampflösend
- wundheilungsfördernd
- antibakteriell
- geruchbindend
- entspannend
- ausgleichend
- antientzündlich
- blutreinigend
- tonisierend
- menstruationsfördernd
- harntreibend
- schmerzlindernd
- schweißtreibend
Anwendungsgebiete:
- Schlaflosigkeit
- Stress
- Nervosität
- Ekzeme
- Verbrennungen
- Zahnfleischentzündungen
- Hautunreinheiten
- Wunden
- Insektenstiche
- Bauchkrämpfe
- Menstruationsbeschwerden
- Blähungen
- Durchfall
- Schnupfen
- Nasennebenhöhlenentzündung
- Husten
- Halsschmerzen
Sammelzeit:
Juni bis August
Aussaatzeit:
März bis April
Blütezeit:
Mai bis September
Standort:
Sonniger Standort; ausreichend Sonne; durchlässiger, sandiger, nicht zu feuchter Boden ohne Staunässe.
Verwechslungsgefahr:
Neben der Echten Kamille gibt es auch giftige Kamillenarten, was eine große Verwechslungsgefahr mit sich bringt. Giftig ist unter anderem die Hundskamille, die nur einen schwachen Duft verströmt und je nach Art sogar unangenehm riecht.
Die Falsche Kamille, wie man sie auch nennt, hat einen gefüllten Blütenboden, während der der Echten Kamille hohl ist. Das lässt sich durch Aufschneiden der Blütenköpfe herausfinden. Zudem sind die Blätter des giftigen Doppelgängers oft breiter.
Die Geruchlose Kamille sieht ähnlich wie die Echte Kamille aus, doch wie ihr Name bereits sagt, hat sie keinen charakteristischen Kamillenduft. Damit besteht kaum Verwechslungsgefahr.
Kein Problem stellt die Verwechslung mit der Römischen Kamille dar, da die Wirkung und Anwendung fast identisch sind. Sie ist lediglich etwas kleiner als die Echte Kamille und wächst mehrjährig. Zudem ist der Köpfchenboden mit Mark gefüllt und nicht hohl.
❮ Zurück zur Übersicht
Mehr aus dem Heilpflanzen Lexikon
Beliebt in Heilpflanzen
Ist es auch dir wichtig, dass wir Menschen wieder zurück zur Natur finden?
Dann unterstütze uns dabei, hilfreiches Wissen zu verbreiten, indem du diesen Beitrag mit deinen Freunden teilst. Vielen Dank!
Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, interessieren dich vielleicht die exklusiven Inhalte der Schöpferinsel. Klicke einfach hier, um zu den unveröffentlichten Extras und Inhalten zu gelangen (kostenlos).